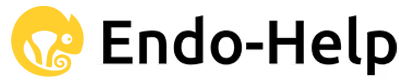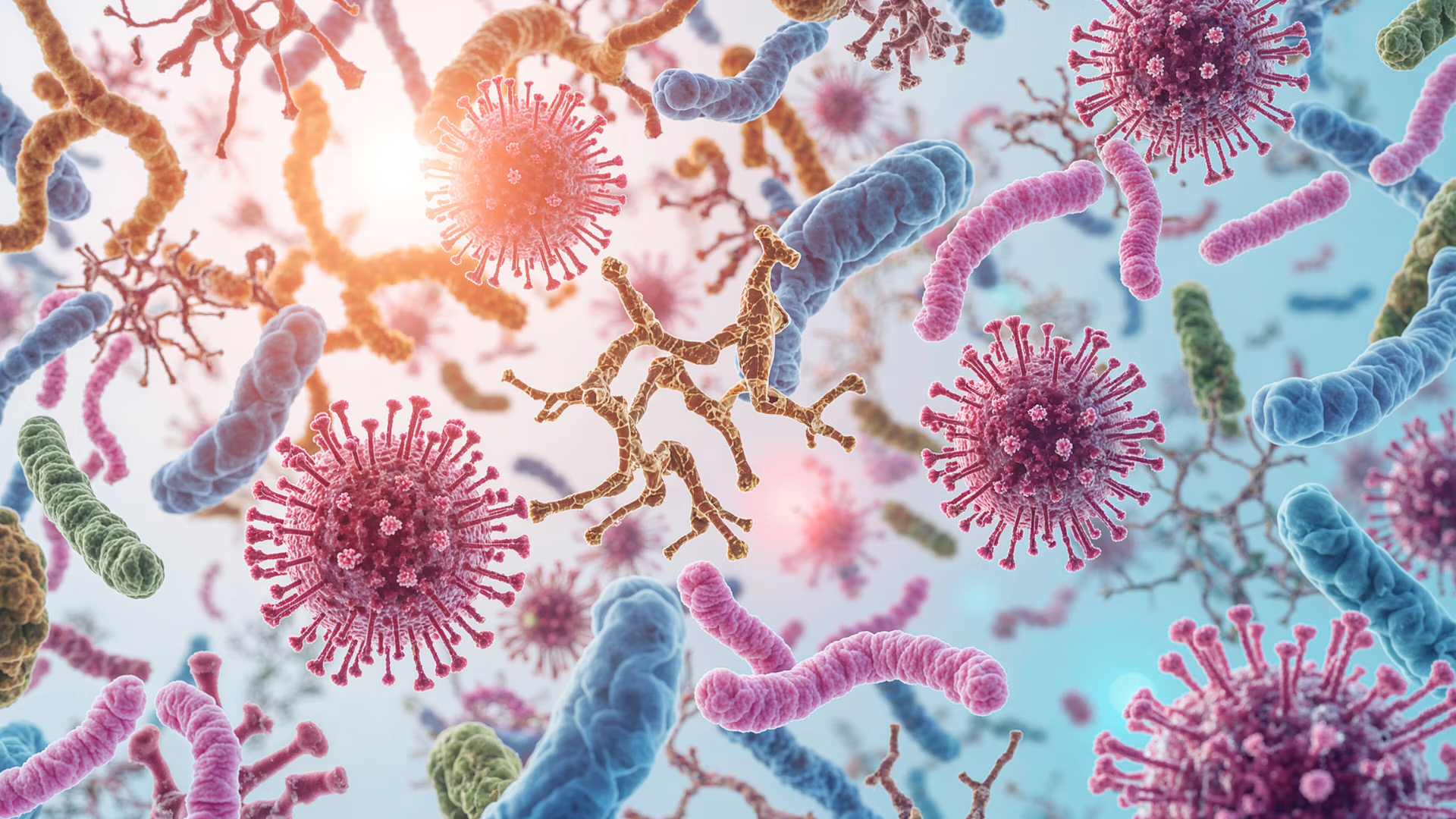Was versteht man unter dem Begriff Mikrobiom?
Dr. med. Nicolas Samartzis: Das Mikrobiom bezeichnet die Gesamtheit aller Mikroorganismen, die im menschlichen Körper leben. Sie besiedeln verschiedenste Körperregionen, insbesondere den Magen-Darmtrakt, aber auch die Haut und den Urogenitaltrakt – von der Scheide über die Gebärmutter und Eileitern, bis hin zur Bauchhöhle. Lange Zeit dachte man, dass die Gebärmutter- und Bauchhöhle steril sei. Dem ist aber nicht so. Die Keime beeinflussen viele Prozesse im Körper, darunter die Verdauung, das Immunsystem, aber auch den hormonellen Metabolismus und die neuronale Aktivität inklusiv Schmerzverarbeitung.
Welchen Einfluss hat das Mikrobiom auf die Endometriose?
Dr. med. Nicolas Samartzis: Das Mikrobiom scheint bei der Endometriose, wie auch bei anderen chronischen Schmerzerkrankungen einen deutlichen Einfluss zu haben. Studien zeigen, dass Frauen mit Endometriose ein verändertes Mikrobiom gegenüber nicht-betroffenen Frauen haben. Hier wird auch von einem gestörten Mikrobiom oder Dysbiosis gesprochen. Dabei handelt es sich nicht um einzelne pathogene Keime innerhalb der Vielzahl unterschiedlicher Mikroorganismen, sondern vielmehr um eine bestimmte Gruppe von Bakterien – insbesondere Anaerobier sowie solche, die bei der sogenannten Gram-Färbung gramnegativ erscheinen. Schon länger ist bekannt, dass bestimmte mikrobielle Arten Entzündungsreaktionen auslösen können. Darüber hinaus konnte nachgewiesen werden, dass einige Mikroorganismen auch Schmerzreaktionen über chemische Signale beeinflussen und sogar Hormone wie Östrogene in aktivere, metabolische Formen umwandeln können – ein Prozess, der wiederum die Aktivität der Endometriose stimulieren kann. Eine weitere interessante Studie hat gezeigt, dass chemische Botenstoffe, die vom Mikrobiom produziert werden, die Blut-Hirn-Schranke überwinden können und dabei sowohl die Stimmung als auch schmerzverarbeitende Regionen im Gehirn beeinflussen.
Kann man ein gestörtes Mikrobiom antibiotisch behandeln?
Dr. med. Nicolas Samartzis: Studien konnten zeigen, dass bestimmte Antibiotika, wie zum Beispiel Metronidazol, anaerobe Keime im Mikrobiom reduzieren und in Laborversuchen sogar das Wachstum von Endometriose-Herden hemmen können. Unklar ist jedoch, ob dieser Effekt auch nach Beendigung der Therapie anhält oder ob es durch die individuelle Wirtsumgebung zu einer erneuten Fehlbesiedelung kommt. Bisher existieren nur wenige Studien, die den Einsatz von Antibiotika bei Menschen mit Endometriose untersucht haben. In einer randomisierten, verblindeten Studie erhielten Patientinnen nach einer Endometriose-Operation entweder Metronidazol oder ein Placebo. Eine Nachbefragung nach sechs Monaten zeigte leider jedoch keinen signifikanten Unterschied in der Schmerzreduktion zwischen den beiden Gruppen.
Gibt es weitere Therapie-Möglichkeiten?
Dr. med. Nicolas Samartzis: Ja. Derzeit erscheint die Kombination aus Probiotika und gezielter Ernährungsumstellung vielversprechender und nachhaltiger als der alleinige Einsatz von Antibiotika zu sein. Da die Ernährung massgeblich die Zusammensetzung des Mikrobioms beeinflusst, überrascht es nicht, dass sie auch einen deutlichen Einfluss auf das endometrioseassoziierte Beschwerdebild haben kann. In diesem Zusammenhang lässt sich sogar von einem indirekten pharmakologischen Effekt der Ernährung sprechen. Allgemein anti-entzündliche Kostformen – etwa der Verzicht auf FODMAPs, rotes Fleisch oder entzündungsfördernde Fette – können unterstützend wirken. Gleichzeitig ist es wichtig, individuelle Unverträglichkeiten (wie z. B. Laktoseintoleranz) zu identifizieren. Dies unterstreicht die zentrale Bedeutung der Ernährungsberatung in der multimodalen Therapie der Endometriose. Wir sind gespannt, was die zukünftigen Forschungsresultate im Bereich des Mikrobioms offenbaren werden und welche neuen Therapieformen sich daraus ergeben.